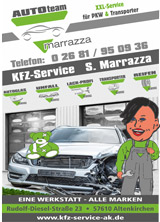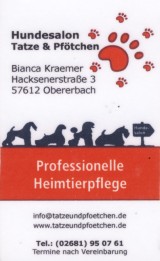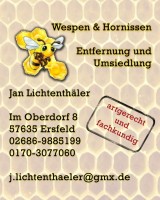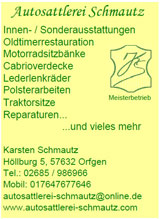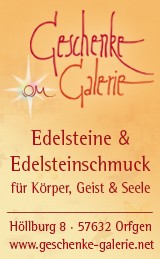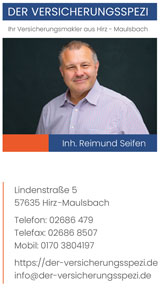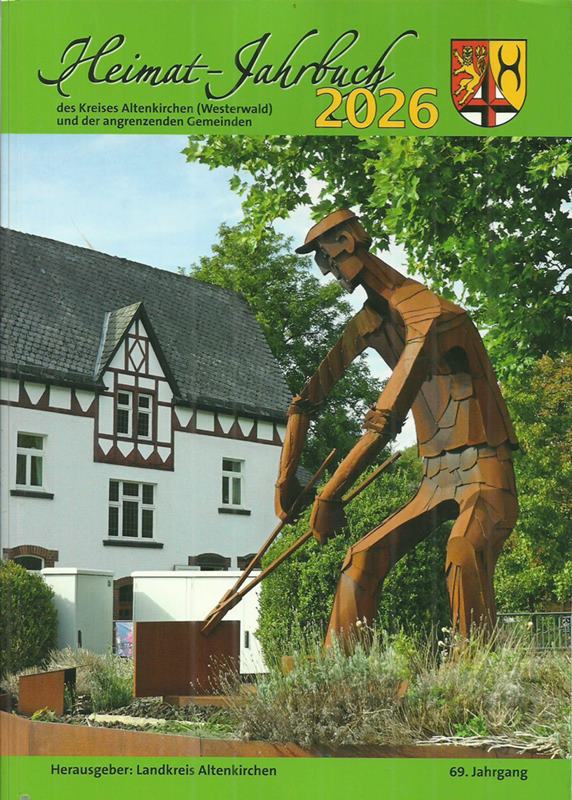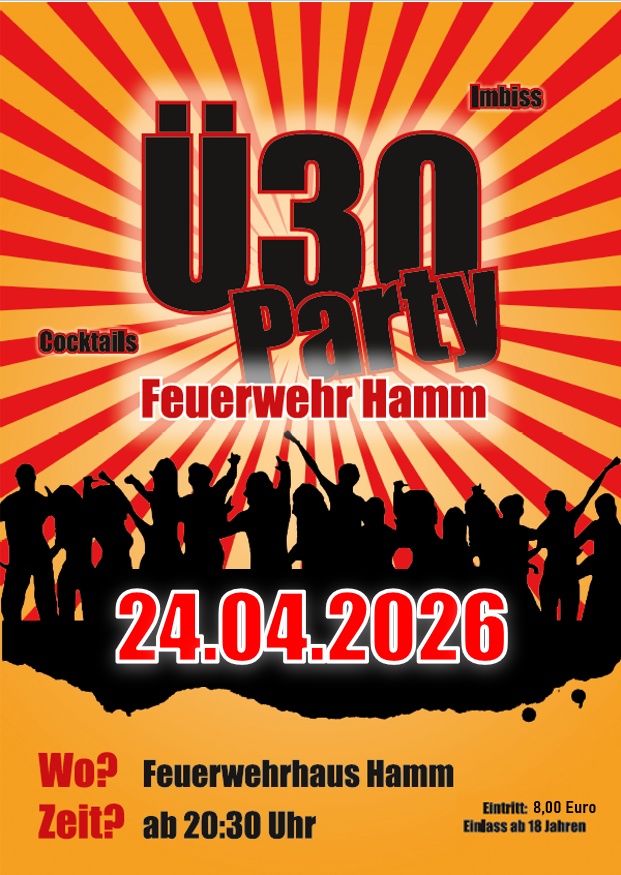REGION – Therapieplätze fehlen – und der Nachwuchs kämpft mit hohen Hürden – Psychische Gesundheit in der Krise: Warum der Weg zur Therapeutin so schwer bleibt – Breitenauerin macht auf Probleme in der Therapeutenausbildung aufmerksam
REGION – Therapieplätze fehlen – und der Nachwuchs kämpft mit hohen Hürden – Psychische Gesundheit in der Krise: Warum der Weg zur Therapeutin so schwer bleibt – Breitenauerin macht auf Probleme in der Therapeutenausbildung aufmerksam
Der Bedarf an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wächst stetig, gleichzeitig warten Betroffene vielerorts monatelang auf einen Therapieplatz. Besonders in ländlichen Regionen wie dem Westerwald ist die Versorgungslage angespannt. Darauf macht auch die Breitenauerin Esther Piontek aufmerksam, die selbst den Weg in den psychotherapeutischen Beruf einschlagen möchte – und dabei auf hohe finanzielle und strukturelle Hürden stößt.
Der Ausbildungsweg zur approbierten Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten ist lang und komplex. Er führt über ein Bachelor- und Masterstudium in Psychologie mit klinischem Schwerpunkt hin zur Approbation und anschließend zur mehrjährigen fachlichen Weiterbildung – ein Prozess, der häufig acht bis zehn Jahre dauert.
An staatlichen Universitäten in Rheinland-Pfalz, etwa in Mainz, Trier oder Landau, werden inzwischen neue, approbationsfähige Studiengänge angeboten. Der Zugang ist jedoch stark begrenzt: hohe NC-Werte und wenige Studienplätze erschweren vielen Interessierten den Einstieg. Für Personen, die sich erst im späteren Berufsleben neu orientieren möchten, ist zudem ein Vollzeitstudium an einer staatlichen Universität oft nicht mehr mit dem eigenen Lebensmodell vereinbar.
Bleiben private Hochschulen – doch diese sind kostspielig. Studiengebühren zwischen 20.000 und 40.000 Euro sind keine Seltenheit. Seit der Reform des Psychotherapeutengesetzes 2020 dürfen nur noch Universitäten mit spezieller Approbationszulassung das neue Studium anbieten, und bundesweit verfügen bisher nur wenige über diese Akkreditierung. Dadurch hat sich die Zahl der Studienplätze weiter verringert, insbesondere außerhalb der Großstädte.
Mit der Reform wurde zwar festgelegt, dass die anschließende psychotherapeutische Weiterbildung künftig vergütet und nicht mehr selbst finanziert werden soll. Doch die Umsetzung stockt: Eine verbindliche bundesweite Finanzierung fehlt bislang, und vielerorts existieren noch kaum bezahlte Weiterbildungsstellen. Parallel laufen die alten, kostenpflichtigen Ausbildungsmodelle weiter – mit Gebühren zwischen 13.000 und 20.000 Euro allein in Rheinland-Pfalz. Zudem gibt es derzeit zu wenige Plätze für die neue Weiterbildung.
Auch nach der Ausbildung bleiben strukturelle Hürden bestehen: Die Zahl der Kassensitze – also der Zulassungen für die Behandlung gesetzlich Versicherter – ist seit Jahren stark begrenzt. In vielen Regionen sind alle Sitze belegt, Übernahmen erfolgen selten und zu hohen Kosten. So entsteht ein weiterer Engpass, der den Mangel an Therapieplätzen zusätzlich verschärft.
Diese finanziellen und strukturellen Barrieren führen dazu, dass weniger Menschen den Weg in den psychotherapeutischen Beruf einschlagen. Die Folgen zeigen sich bundesweit – und auch im Westerwald: Wartezeiten verlängern sich, Praxen sind überlastet, Betroffene bleiben länger ohne Hilfe.
Gerade in Zeiten wachsender psychischer Belastungen braucht es politische und gesellschaftliche Lösungen: neue Fördermodelle, gezielte Unterstützung für Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, ausreichend Weiterbildungs- und Kassensitze sowie eine realistischere Gestaltung der Ausbildungskosten.
Denn psychische Gesundheit darf kein Privileg sein – weder für jene, die Hilfe suchen, noch für jene, die helfen wollen. (Esther Piontek)