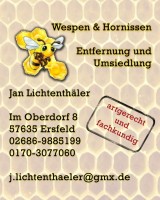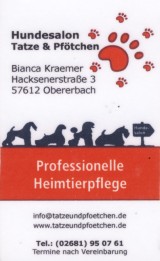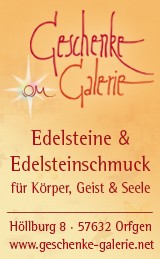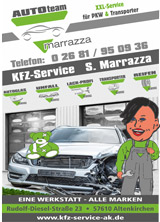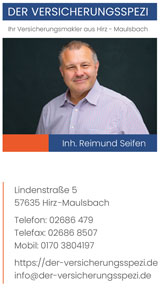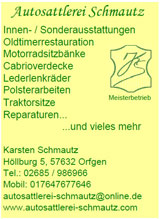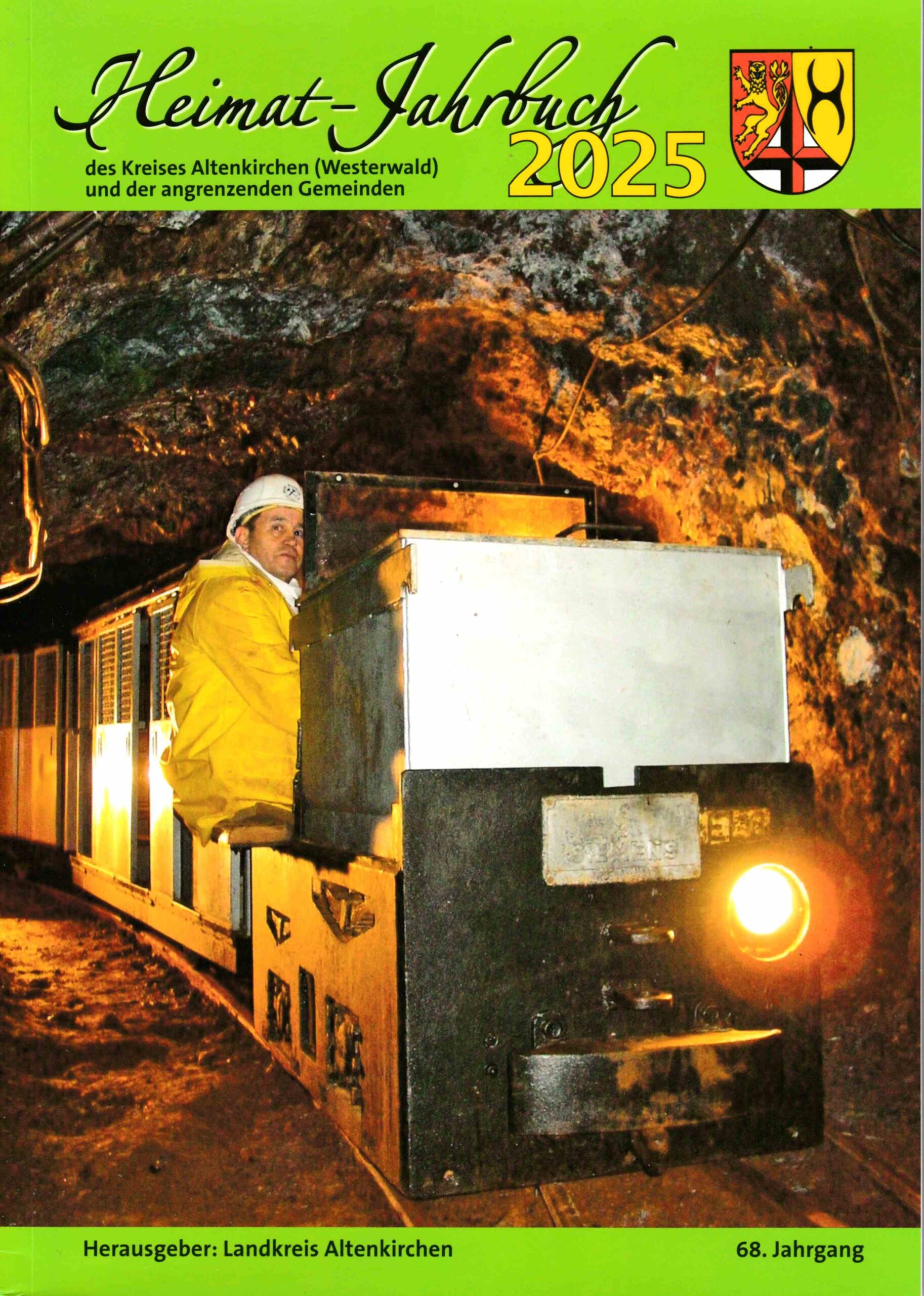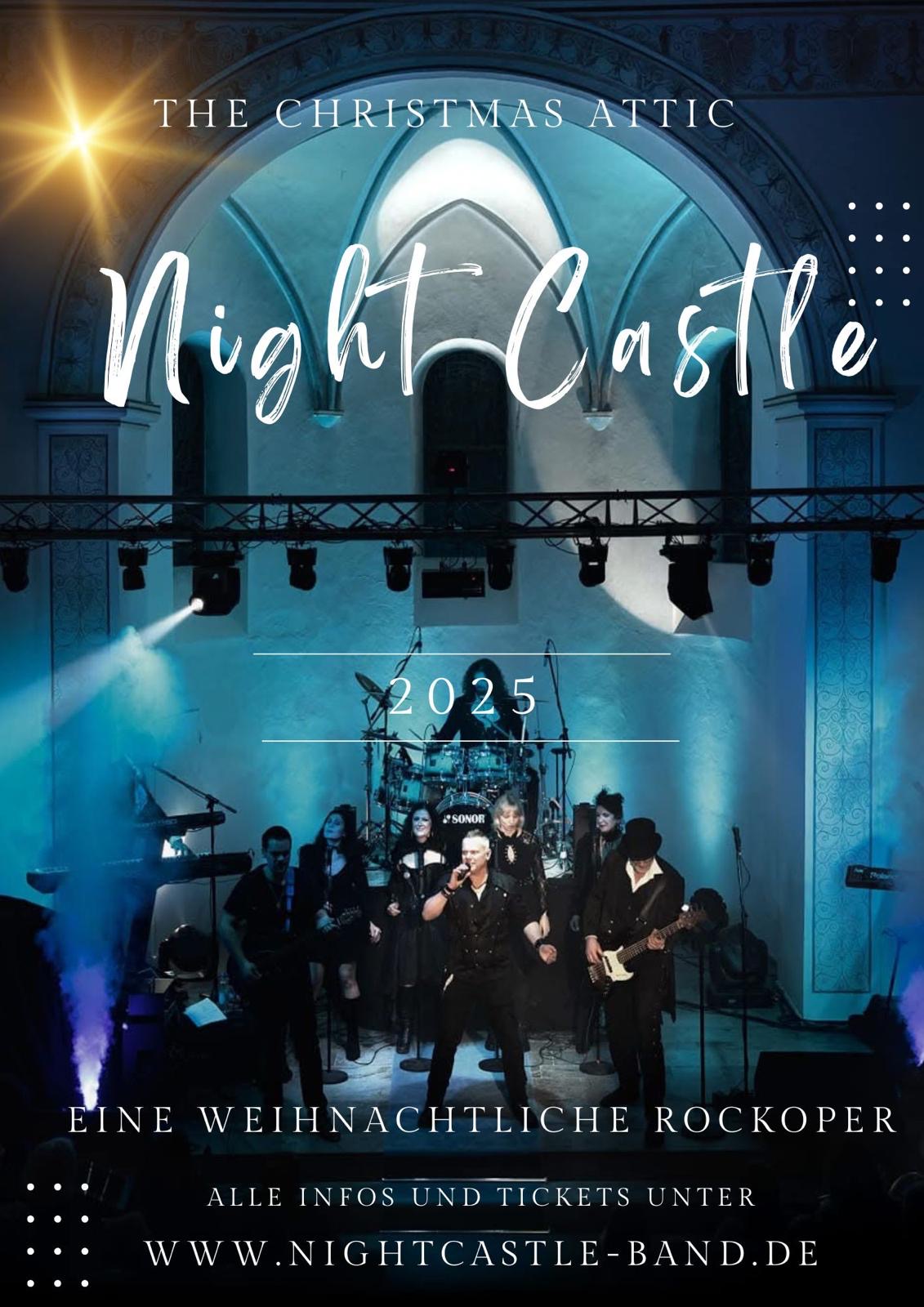Vorstellungsveranstaltung „Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten an der Nister (INTASAQUA)“
 NISTER – Vorstellungsveranstaltung „Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten an der Nister (INTASAQUA)“ – An der Nister startet ein neues Artenschutz-Vorhaben mit Modellcharakter. Die Nister und ihre Nebengewässer beheimaten sehr viele zum Teil sehr seltene Tierarten, wie den Lachs, die Bachmuschel und die letzten Exemplare der vom Aussterben bedrohten Flussperlmuschel. Diese Arten sind auf intakte Strukturen und eine gute Gewässerqualität angewiesen. In den vergangenen Jahren war allerdings eine stetige Verschlechterung zu beobachten – nicht nur an der Nister, sondern auch an vielen vergleichbaren Gewässern in Deutschland.
NISTER – Vorstellungsveranstaltung „Integrativer Artenschutz aquatischer Verantwortungsarten an der Nister (INTASAQUA)“ – An der Nister startet ein neues Artenschutz-Vorhaben mit Modellcharakter. Die Nister und ihre Nebengewässer beheimaten sehr viele zum Teil sehr seltene Tierarten, wie den Lachs, die Bachmuschel und die letzten Exemplare der vom Aussterben bedrohten Flussperlmuschel. Diese Arten sind auf intakte Strukturen und eine gute Gewässerqualität angewiesen. In den vergangenen Jahren war allerdings eine stetige Verschlechterung zu beobachten – nicht nur an der Nister, sondern auch an vielen vergleichbaren Gewässern in Deutschland.
Es existieren bereits zahlreiche Bemühungen, die Nister und ihre Bewohner zu schützen, unter anderem der Abschluss des Nistervertrages im Frühsommer 2017 oder ein von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (kurz: BLE) gefördertes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Verbesserung der Gewässerqualität durch Biomanipulation.
Nun wurden vom Bundesamt für Naturschutz (kurz: BfN) die Voruntersuchungen zu einem von der Universität Koblenz-Landau beantragten Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben zum integrativen Artenschutz bewilligt. Ehrenamtliche Gewässerschützer der Arge Nister e.V. hatten das Projekt gemeinsam mit Wissenschaftlern der Universität entwickelt.
Ziel des Projektes ist es – neben einer kurzfristigen Erhaltung des Reliktvorkommens der Flussperlmuschel – eine Kombination verschiedener Schutzmaßnahmen zu erproben, um die Habitatqualität als Ganzes nachhaltig zu verbessern. Dadurch soll die außerordentlich hohe Biodiversität an der Nister erhalten und entwickelt werden. Die Besonderheit des Vorhabens ist der integrative Ansatz, der darauf abzielt, nicht nur einzelne Arten zu schützen, sondern die ökologische Qualität des Gewässers insgesamt zu verbessern. Davon profitieren letztendlich alle in der Nister heimischen Arten. Gleichzeitig können die Ergebnisse auf andere Fließgewässer mit vergleichbarer Situation übertragen werden.
 In der im Mai begonnenen und bis Ende 2018 laufenden Voruntersuchung finden durch die Universität Koblenz-Landau und die Technische Universität München nun zunächst Geländeuntersuchungen statt, um den aktuellen Zustand der Nister genau zu charakterisieren. Auf dieser Grundlage werden die konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensraumqualität in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Behörden, Anwohnern und Nutzern entwickelt. Die Maßnahmen sollen dabei nicht nur direkt im Gewässer ansetzen, sondern auch die Entwicklung des Gewässerumlandes beinhalten, um den Eintrag von Boden und Nährstoffen zu reduzieren. Sowohl die feinen Bodenpartikel (Feinsedimente) als auch die Nährstoffe tragen dazu bei, die Gewässersohle zu verstopfen. Dadurch können diese für viele Tiere wichtigen Lebensräume im Gewässergrund nicht mehr ausreichend mit frischem, sauerstoffreichem Wasser durchflossen werden.
In der im Mai begonnenen und bis Ende 2018 laufenden Voruntersuchung finden durch die Universität Koblenz-Landau und die Technische Universität München nun zunächst Geländeuntersuchungen statt, um den aktuellen Zustand der Nister genau zu charakterisieren. Auf dieser Grundlage werden die konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensraumqualität in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, Behörden, Anwohnern und Nutzern entwickelt. Die Maßnahmen sollen dabei nicht nur direkt im Gewässer ansetzen, sondern auch die Entwicklung des Gewässerumlandes beinhalten, um den Eintrag von Boden und Nährstoffen zu reduzieren. Sowohl die feinen Bodenpartikel (Feinsedimente) als auch die Nährstoffe tragen dazu bei, die Gewässersohle zu verstopfen. Dadurch können diese für viele Tiere wichtigen Lebensräume im Gewässergrund nicht mehr ausreichend mit frischem, sauerstoffreichem Wasser durchflossen werden.
Die Entwicklung und Ausbreitung der Tierpopulationen wird dadurch verhindert. Diese als „Kolmation“ bezeichnete Abdichtung der Gewässersohle wurde bisher als eines der wichtigsten Probleme für das Überleben der bedrohten Arten an der Nister und an ähnlichen Flüssen identifiziert.
Bis Ende 2018 soll in Kooperation aller Beteiligten, unter Federführung der Unteren Wasserbehörde bei der Kreisverwaltung Altenkirchen, der Antrag für ein dreijähriges Hauptvorhaben entwickelt und eingereicht werden, in dem die praktische Umsetzung und Erprobung des Maßnahmenkonzeptes geplant ist.
Als Projektträger soll der Kreis Altenkirchen fungieren, der durch den Westerwaldkreis und einige am Nistervertrag beteiligte Verbandsgemeinden unterstützt wird. Neben der beim BfN zu beantragenden Förderung im Umfang von maximal 66 Prozent der Projektausgaben, hat das Land Rheinland-Pfalz bereits eine finanzielle Beteiligung in Höhe von rund 24 Prozent zugesagt. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 10 Prozent der Gesamtkosten wollen die beiden Landkreise mit Unterstützung der Verbandsgemeinden Hachenburg, Hamm, Altenkirchen, Wissen und Gebhardshain einbringen. Parallel zur praktischen Erprobung soll eine wissenschaftliche Begleituntersuchung den Erfolg der umgesetzten Maßnahmen ermitteln.
Die Beteiligten an diesem Projekt gehen davon aus, dass dieser integrative ökologische Ansatz unter Einbeziehung verschiedener Interessengruppen bei der Umsetzung der Maßnahmen ein wichtiger Schritt für die Erhaltung der Artenvielfalt an der Nister ist, aber auch ein Beispiel für andere Gewässerschutzprojekte sein kann.